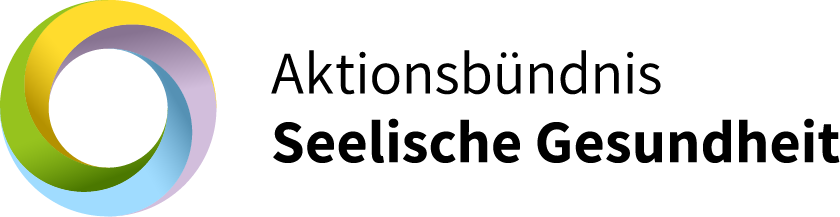So hilft die Jugendhilfe
Interview mit Miriam Egeler und Daniel Fürg
Miriam Egeler von der Jugendhilfe der Diakonie Oberbayern spricht im Goldkind-Podcast mit Moderator Daniel Fürg darüber, wie Kinder Kontakt mit der Jugendhilfe aufnehmen können, wie und wo die Jugendhilfe bei komplizierten Familiensituationen Unterstützung bietet und wie Biografien von jungen Menschen, die als schwierig gelten, dann dennoch gelingen können.
Wir reden immer von den ‚schwierigen Jugendlichen‘. Wie würden Sie die definieren?
Prinzipiell würde ich alle Personen darunter fassen, bei denen andere Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern sagen, sie kommen mit der Person nicht zurecht, bei der es so viele Verhaltensauffälligkeiten gibt, so viel Unlust an Teilnahme, dass sie im normalen Regelsystem weder betreubar noch beschulbar ist. Wir bekommen hier von Fachkräften Hilferufe, dass es so nicht mehr geht. Das sind die Personen, die unser Interesse wecken. Die sind herausfordernd – auch für ein System. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen am System, das die Kinder herausfordern wollen oder müssen.
„Es gibt aus meiner Erfahrung nicht den einen einzigen Faktor, sondern viele kleine, die sonst eigentlich nicht schlimm wären, aber wenn sie sich potenzieren und zu lange vor sich hin köcheln, dann kommt es eben zu diesen Schwierigkeiten.“
Aus Ihrer Erfahrung heraus, was sind die Gründe, warum die Jugendlichen so sind, wie sie sind? Liegt es an der Familie, am Umfeld oder an was ganz anderem?
Das ist unterschiedlich. Was wir erleben, ist oftmals ein Elternhaus, das gar nicht aus bösem Willen, das aber in irgendeiner Konstellation so handelt, dass ein Bedürfnis eines Jugendlichen nicht registriert oder übersehen wird. Das können Situationen sein wie Geschwister, die nachkommen, Patchwork-Konstellationen, ein neuer Partner, andere familiäre Krisen wie etwa der Todesfall von Großeltern, Arbeitslosigkeit, Erkrankung et cetera.
Was wir auch erleben ist, dass Kinder aus einem behüteten Umfeld kommen, dann aber in Freundeskreise geraten, bei denen gewisse Interessen eine Rolle spielen. Das bekommen die Eltern vielleicht gar nicht mit, und der Sog der Peergroup, der man es in der Pubertät nochmals ganz anders beweisen will, ist auf einmal zu groß. Natürlich spielt auch die Leistungsgesellschaft eine Rolle, sodass manche junge Menschen dem schulischen Druck nicht gerecht werden. Dann gibt es aber natürlich auch Krankheitsbilder, die dazu führen, dass die Dinge nicht so gut verarbeitet werden können. Das passiert, wenn beispielsweise ein Förderbedarf da ist, den man erst mal nicht registriert oder ignoriert, weil man die jungen Menschen nicht stigmatisieren will oder nicht will, dass sie zum Psychologen müssen, und Sorge vor der Reaktion der Umwelt hat. Es gibt aus meiner Erfahrung nicht den einen einzigen Faktor, sondern viele kleine, die sonst eigentlich nicht schlimm wären, aber wenn sie sich potenzieren und zu lange vor sich hin köcheln, dann kommt es eben zu diesen Schwierigkeiten.
Kann man sagen, dass mit dem unangepassten Verhalten vielleicht nur eine Hilflosigkeit übertüncht wird?
Ja, sehr oft ist die Motivation, etwas gegen Unsicherheit zu tun und dazugehören zu wollen oder etwas besonders gut zu können, auch wenn es nur negatives Verhalten ist. Vielfach hat der junge Mensch auch gelernt, dass man sich Erwachsene damit ganz schnell vom Hals schafft, indem man um sich beißt und Menschen von sich wegtreibt. Oder es wird sich so verhalten, dass andere nicht mehr wegschauen können und man endlich die Aufmerksamkeit bekommt. Das sind oft erlernte Muster, bei denen wir erst mal schauen müssen, was das eigentliche Interesse dahinter ist und wie man vielleicht was anderes in den Mittelpunkt stellen kann.
„Wir schauen, ob wir eine Person haben, die sich einen guten Kontakt zu dem jungen Menschen erarbeiten kann“
Wo setzen Sie an?
Wir wollen für jeden jungen Menschen eine Antwort haben. Wir schauen, ob wir ein vorübergehendes Zuhause anbieten können und ob wir eine Person haben, die – warum auch immer – sich einen guten Kontakt zu dem jungen Menschen erarbeiten kann, sei es über gemeinsame Sport- oder Musikinteressen oder andere Gemeinsamkeiten. Und dann sagen wir nicht zu ihm: „Das ist unser System, so musst du funktionieren.“ Sondern wir stellen unsere Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen in der Wohngruppe oder in der Inobhutnahmestelle oder im betreuten Wohnen auf den Prüfstand und versuchen sie anzupassen, damit ein junger Mensch nicht immer gegen Mauern rennt und diese einzureißen versucht, sondern sich gut zurechtfinden kann. Manchmal ist das nicht so einfach, manchmal sind bestimmte Zielsetzungen, bestimmte positive Ergebnisse, die man sehen will, mit der Bewilligung von Geldern verknüpft. Und manchmal dauert so eine Entwicklung vielleicht länger, als wir den Atem haben dürfen.
Wie kommen die Jugendlichen zur Jugendhilfe? Wie entsteht der erste Kontakt?
An sich ist das ein komplexes System, es gibt verschiedene Zugänge. Die jungen Menschen, die noch nie was mit der Jugendhilfe zu tun hatten, landen bei uns häufig zum Beispiel über die Schulsozialarbeit oder die Betreuer:innen in einer Ganztagseinrichtung oder im Jugendzentrum, denen auffällt, da stimmt was nicht. Oder der junge Mensch vertraut sich an und sagt, dass zu Hause etwas schwierig ist. Dann gibt es meist einen Kontakt zum Jugendamt. Dort wird auch geprüft: Muss der junge Mensch erst mal in Obhut genommen werden? Ist das der Fall, so kommen die Betroffenen in eine der Inobhutnahmestellen in München, zum Beispiel auch bei uns. Das ist meistens nur ein Erstkontakt. Da kann es sein, dass ein junger Mensch erst mal nur für zwei Tage bei uns ist und man dann nach der Überprüfung gewisse Regelungen zu Hause schafft. Dann kehrt der junge Mensch oftmals wieder heim, weil es zu Hause doch schöner ist als in einer Einrichtung.
Und dann gibt es die jungen Menschen, die einfach schon im System bekannt sind, die, die wir eher als sehr herausfordernd erleben, die meistens bereits eine gewisse Karriere hinter sich haben, viele Abbrüche und Beziehungs- und Standortwechsel erlebt haben. Hier kommt meistens die Anfrage über das Jugendamt, das den jungen Menschen unterbringen muss, der aber woanders – aus vielerlei Gründen – vielleicht nicht hineinpasst.
„Dann kehrt der junge Mensch oftmals wieder heim, weil es zu Hause doch schöner ist als in einer Einrichtung.“
Wie viele Jugendliche sind bei der Jugendhilfe in Betreuung?
Wir sind nur ein Träger in der Jugendhilfe. Bei uns gibt es 30 Inobhutnahmeplätze, wir haben 60 bis 70 Wohngruppenplätze und 140 Plätze in den betreuten Wohnformen und dann noch spezielle Angebote wie Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen, wo wir nochmal 20 bis30 Plätze zur Verfügung haben. Insgesamt sind es 200 bis 220 Mitarbeiter:innen, die sich um die jungen Menschen kümmern, die nicht mehr zu Hause wohnen, die vorübergehend oder langfristig ein anderes Zuhause brauchen. Daneben gibt es unter unserem Träger ambulante Erziehungshilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit, Kindertagesbetreuung. Und dann sind da natürlich parallel zu uns noch viele andere Jugendhilfeträger aktiv.
Ab welchem Alter fangen Sie mit der Betreuung an? Gibt es da eine definierte Altersgrenze?
Bei der Inobhutnahme nehmen wir erst Kinder ab 6 Jahren auf, in den Wohngruppen erst ab 10 Jahren. Im Mutter-Kind-Bereich sind die Mütter die Zielgruppe und die Kinder dann zwischen 0 und 6.
Das obere Ende ist dann …
…in der klassischen Jugendhilfe 18 oder 21 Jahre. Manchmal geht die Unterstützung über den Bezirk auch noch mal über das 21. Lebensjahr hinaus. Im Mütter-Kind-Bereich sind die Mütter teilweise zwischen 30 und 40.
Wie ist Ihre Erfahrung: Lässt sich bei den Jugendlichen ein nachhaltiger positiver Wandel mitgestalten? Bekommen die Jugendlichen durch die Arbeit der Jugendhilfe ein besseres Leben beziehungsweise eine bessere Zukunftsperspektive? Oder müsste das System verbessert werden?
Als überzeugte Sozialpädagog:innen müssten wir jetzt sagen: Natürlich verbessern wir die Welt. Und das tun wir an ganz vielen Stellen tatsächlich. Es gibt da auch viele Positivbeispiele: Wir haben eine junge Frau, die bei uns das Duale Studium absolviert, die vor einigen Jahren bei uns in der Wohngruppe eingezogen ist und da festgestellt hat, dass genau das ihr den Weg bereitet hat, ihr Leben noch mal ganz anders zu gestalten. Dazu hat beigetragen, dass jemand für sie da war und sich um sie gesorgt hat. Sie hat festgestellt, das will sie weitergeben, und jetzt arbeitet sie bei uns. Solche Positivbeispiele gibt es nicht immer in dieser Ausprägung, aber ich glaube, dass wir für jeden jungen Menschen, der erst mal bei uns zur Ruhe kommt, einen positiven Effekt haben. Die Frage ist immer, was können wir im System, im familiären Umfeld bewegen, was können wir an neuen Handlungsweisen mittrainieren, damit die jungen Menschen in der Gesellschaft besser vorankommen und sich zu einer gemeinschaftsfähigen Person entwickeln. Ich glaube, das müssen die jungen Menschen bei uns auf eine harte Art kennenlernen. Die wenigsten von uns müssen schließlich mit sieben, acht Geschwistern aufwachsen, die sie nicht kennen und die ständig wechseln. Da wird ihnen viel abverlangt – auch sich auf viele Mitarbeiter immer wieder neu einzulassen. Für die meisten bewegt es sich sicherlich positiv. Aber wir können nicht alle erreichen. Manche sind auch zu fertig mit dem System, mit den Erwachsenen, sind zu oft enttäuscht worden et cetera. Dann muss man schauen, ob der junge Mensch vielleicht zwischendurch einen Klinikaufenthalt braucht, um ein Stück weit runterzukommen, um dem Stress von außen entgehen zu können.
„Man versucht, genau hinzuschauen, man versucht, viel innerhalb der Familie zu regeln.“
Es muss ja schon einiges passieren, dass ein Kind oder eine Jugendliche in Obhut genommen wird. Was haben die Kinder und Jugendlichen erlebt?
Bei der Inobhutnahme gibt es ganz unterschiedliche Gründe: ein Streit zu Hause, der eskaliert. Zum Beispiel, dass dem jungen Menschen das Handy abgenommen wird, der fühlt sich ungerecht behandelt und macht da eine ganz andere Geschichte daraus, zum Beispiel, dass er bedroht wird. Wenn das glaubhaft ist, gibt es zunächst eine Überprüfung. Und während dieser Überprüfung ist der junge Mensch erst mal nicht zu Hause. Wir haben es im Inobhutnahmebereich bei den Kindern unter 12 Jahren oftmals mit Gewalt zu tun, wo die jungen Menschen manchmal nur Zuschauer, manchmal aber auch beteiligt sind. Hier muss man herausfinden, ob die Kinder zu Hause gut versorgt sind.
Aber es ist nicht so, wie man es sonst gerne mal liest, dass man da einmal einen lauteren Streit hat in der Familie, dann klingelt es an der Tür, die Polizei mit dem Jugendamt steht vor der Tür und das Kind ist weg. Man versucht, genau hinzuschauen, man versucht, viel innerhalb der Familie zu regeln. Nur wenn das nicht funktioniert, dann kommt es oft zu einer kurzfristigen Herausnahme. Dann wird versucht, die Situation zu Hause zu stabilisieren, sodass das Kind vielleicht wieder dort hingehen kann.
Und dann gibt es die Familien, die manchmal über Generationen in der Jugendhilfe sind, wo man zwar versucht, das System zu stabilisieren, aber an die Grenzen der Ressourcen stößt, weil die Menschen nicht wollen und unser Lebensmodell auch für sich nicht als ihres beschreiben würden. Bei manchen passieren auch aus einem anderen kulturellen Hintergrund Sachen, die wir mit unserem Verständnis von Kinderschutz nicht unterstützen können, und dann kommt es zu dem Herausnahmen. Bei den Wohngruppen gibt es meist dann Neuzugänge, wenn die Familienverhältnisse zerrüttet sind. Oft sind es sogar die Eltern, die sagen: „Es geht nicht mehr.“ Oder diese haben noch jüngere Kinder, die durch den Drogenkonsum der oder des älteren Geschwisters gefährdet sind. Genauso gibt es junge Menschen, die sagen: „Ich möchte nicht mehr nach Hause.“
Welche Rolle spielen psychische Erkrankungen von Elternteilen?
Gefühlt gab es diese schon immer. Aber man hat schon den Eindruck, dass der gesellschaftliche Druck steigt und dass es derzeit mehr Erkrankungen von Elternteilen oder Sorgeberechtigten gibt, wo deren Verhalten für die jungen Menschen nicht mehr kalkulierbar ist. Häufig sind die Eltern schon in der Therapie, manchmal reicht das aber trotzdem nicht. Manchmal ist es auch besser, dass die betroffenen Eltern sich auf sich und ihre Krankheit konzentrieren können und einen entspannteren Kontakt zum Kind haben, weil das Kind einfach nicht mehr im Alltag bei ihnen lebt.
Hilft es eigentlich, dass man heute offener über mentale Gesundheit spricht?
Es hilft schon, weil man jungen Menschen auch viel eher erklären kann, dass es nicht dran liegt, dass die Mama sie nicht liebhat, sondern dass sie gerade halt nicht kann. Und man kann heute viel besser zugeben, dass es einem gerade nicht gut geht. Das ist gut. Wir müssen nur umgekehrt aufpassen, dass wir den jungen Menschen oder auch den Eltern nicht zu früh einen Stempel verpassen und sie stigmatisieren.
„Unser Ziel ist, dass die Kinder zurückgehen können, wenn es für alle Seiten gut passt.“
Wenn Kinder aufgrund der Probleme ihrer Eltern vorübergehend zu Ihnen kommen, hat man dann die Chance, die Situation zu Hause so nachhaltig zu verbessern, dass der junge Mensch wieder zurückkann und dann nicht wieder ein Jahr später vor der Tür steht?
Das gelingt häufig. Es passiert nicht über Nacht oder über ein Wochenende, aber wenn man langfristig daran arbeitet, dass das Eltern-Kind-Verhältnis einfach spannungsfreier wird, dann haben beide Seiten das Interesse, dass es wieder zurückgehen kann. Dann sind die Eltern vielleicht auch bereit, sich weitere Unterstützung zu holen. Wir haben in den meisten Einrichtungen auch Fachdienstangebote, wo wir Elterngespräche anbieten, bei denen ein Psychologe oder eine Heilpädagogin anwesend sind, wo man noch mal auf anderem Weg sucht, was die Familie unterstützen könnte. Wir haben den Eindruck, dass wir von den Eltern nicht so feindlich angesehen werden. Unser Ziel ist, dass die Kinder zurückgehen können, wenn es für alle Seiten gut passt.
Sie versuchen also auch zu helfen, indem Sie die Tür für eine Therapie der Eltern öffnen?
Wir versuchen immer auch, mit dem Familiensystem zu arbeiten. Das ist manchmal allerdings eine Ressourcen- und Personalfrage. Das kann in Zukunft aber besser werden, da sind viele neue Konzepte am Start. Wir müssen die Angebote, die wir den jungen Menschen machen, auch den Eltern vorstellen, damit sie dem zustimmen können. Wenn zum Beispiel die Eltern gegen therapeutische oder medikamentöse Behandlung sind, dann können wir die jungen Menschen über den Widerstand hinaus auch nicht motivieren. Deswegen müssen wir das ganze System bewegen.
„Wir werden Familie nicht ersetzen können“
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu Eskalationen kommt, wenn belasteten Eltern ihre Kinder weggenommen werden. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Da muss man unterscheiden. In den Wohngruppen ist es ganz anders, weil die Betreuung dort für die Familie meistens nicht neu ist und es da meistens einen ganz anderen Kontakt gibt. Meistens gilt die Jugendhilfe hier als okay. Trotzdem gibt es auch hier die Eltern, die kein Interesse an ihren Kindern haben, die sehen wir nie. In der Inobhutnahme ist das anders, da kommt es darauf an, warum das Kind bei uns ist, zum Beispiel ob es eine negative Vorgeschichte mit dem Elternhaus gibt. Da darf es am Anfang keinen Kontakt geben. Wir haben bei uns auch Kinder, die anonym untergebracht sind, bei denen die Familie nicht weiß, wo sie sind. Später gehen wir relativ schnell in Kontakt, sofern daraus kein Schaden für das Kind zu erachten ist, weil uns die Beziehungen wichtig sind. Aber wenn Familiensysteme die Kinder „entfernt“ bekommen, dann ist der Kooperationswille der Eltern relativ gering. Das kann dann bis zu polizeilichen Anzeigen gegen die Einrichtungen gehen. Hier geht es darum, die Widerstände zu klären, sodass man mit der Familie wieder arbeiten kann. Am Ende sind wir nur ein Jugendhilfesystem – wir werden die Familie nicht ersetzen können.
Es gibt auch Jugendliche, die selbst initiieren, dass sie in eine solche Wohngruppe kommen. Was würden sie Jugendlichen raten: Was ist der erste Schritt für junge Menschen, die merken, dass sie zu Hause rausmüssen?
Der erste Schritt wäre, dass man sich beim Jugendamt meldet. Nun ist diese Hürde erfahrungsgemäß relativ hoch. Das schaffen viele junge Menschen nicht. Deswegen hat man, zum Beispiel in München, eingeräumt, dass es weitere Träger gibt, die Inobhutnahmestellen betreiben. Man kann hier als junger Mensch, quasi wie ein Selbstmelder, einfach auftauchen oder anrufen und sagen, dass man Unterstützung braucht. Dann reagieren die Kolleg:innen sofort. Sie raten dem jungen Menschen, erst einmal herzukommen, bieten etwas zu trinken an und schauen, wo man für die Nacht einen Platz findet.
Alternativ kann ich mich als junger Mensch – und das bestätigt meine Erfahrung der letzten 20 Jahre – an jeden Erwachsenen wenden, wo ich das Gefühl habe, dem kann ich mich anvertrauen. Dann übernehmen diese die Vermittlung. Ein weiterer Weg ist immer die Polizei. Außerhalb der Arbeitszeiten des Jugendamts ist die Polizei die wichtigste Stelle, die die jungen Menschen in Obhut nehmen kann – sie ist bis zum nächsten Werktag zuständig. Damit ist gewährleistet, dass man nicht von Bürozeiten abhängig ist und dass stets für jeden jungen Menschen in einer Notlage ein Ansprechpartner vorhanden ist.

Zur Person Miriam Egeler
Miriam Egeler hat bereits vor ihrem Studium der Sozialen Arbeit mit herausfordernden Jugendlichen gearbeitet, nach dem Abschluss kam sie von Baden-Württemberg nach Bayern, um dort in der Jugendhilfe der Diakonie Oberbayern anzufangen, wo sie heute als Geschäftsbereichsleiterin fungiert.