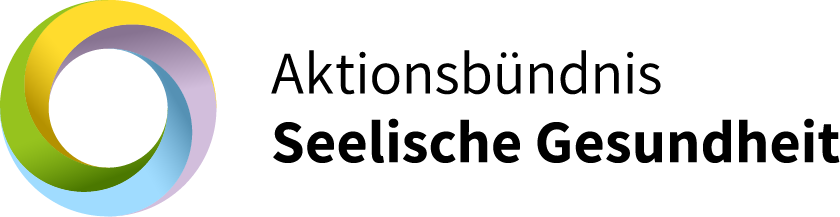Fachbeitrag: Depression
Autorin: Dr. med. Sophie-Kathrin Greiner
Eine Depression ist eine weit verbreitete und ernstzunehmende Störung der Gesamtstimmung. Von einer Depression kann man laut dem Diagnosenkatalog DSM 5 („Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ – ein Klassifizierungssystem zur Bestimmung von psychischen Störungen) ausgehen, wenn die Betroffenen mindestens zwei Wochen lang an einer depressiven Verstimmung und/oder an Freudlosigkeit und Interessenverlust leiden und mindestens fünf der folgenden Symptome auftreten. Das sind: andauernde Energielosigkeit, Traurig- und Hoffnungslosigkeit, deutliche Gewichtsschwankungen, Schlafstörungen, das Gefühl von Getriebensein, das Gefühl von Wertlosigkeit, Konzentrationsstörungen und Suizidgedanken.
„Schätzungsweise erkrankt knapp ein Viertel der Bevölkerung während seines Lebens einmal an einer Depression. Das betrifft sehr viele Menschen. Dennoch wird die Erkrankung häufig noch als stigmatisierend erlebt.“
Sophie-Kathrin Greiner
Bei Depressionen unterscheidet man verschiedene Schweregrade von leicht über mittel bis schwer. Die Schwere wird meist mithilfe eines Patientenfragebogen ermittelt. Die Krankheit verläuft in Episoden. Einige Betroffene erleiden sie nur einmal in ihrem Leben, manche erleiden mehrere Krankheitsepisoden und wieder andere leiden an einer chronischen Depression. Dabei kann sie verschiedene Erscheinungsformen annehmen: Manchmal sind die Betroffenen ermattet, wie leblos, ihnen kommt alles schal und grau vor, sie haben keine Energie, neigen zu Kraftlosigkeit bis hin zu Verwahrlosung. Bei anderen Betroffenen – hier überwiegen die männlichen Patienten – äußert sich die Krankheit durch eine innere Unruhe, durch Gereiztheit, Ängste und Überforderungserleben.
Zumeist lässt sich keine konkrete einzelne Ursache für die Depression festmachen, ihre Entstehung ist „multifaktoriell“. Dazu gehören biologische, soziale und psychische Faktoren. Meist besteht bereits eine gewisse grundlegende Vulnerabilität. Durch zusätzlichen Stress von außen wird der Ausbruch der Erkrankung begünstigt. Unter biologischen Einflüssen versteht man beispielsweise neurochemische Faktoren oder hormonelle Einflüsse. Die Hormonumstellung nach einer Geburt kann so eine Wochenbettdepression auslösen. Zu den Stressfaktoren zählt quasi alles, was von außen auf die Betroffenen wirkt: belastende soziale Situationen (wie z.B. eine Trennung oder der Verlust des Arbeitsplatzes), manche Medikamente, Drogen oder auch jahreszeitliche Einflüsse. Zu den psychischen Faktoren gehören gewisse Grundüberzeugungen und Verhaltensschemata wie beispielsweise erlernte Hilflosigkeit, Aggressionshemmung oder Passivität. Daneben kann die Depression auch im Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen auftreten, so etwa bei bipolaren Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen.
Eine Depression ist eine häufig verbreitete Krankheitsform. Man geht davon aus, dass 16-24 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihrer Lebenszeit einmal an einer Depression leiden. Ein Teil der Erkrankungen bleibt dabei unentdeckt. Ein weiterer Teil wird von den Betroffenen vor dem Umfeld verschwiegen, weil die Krankheit immer noch als stigmatisierend empfunden wird. Deswegen ist an dieser Stelle eine größere Aufklärung in der Gesellschaft und eine größere öffentliche Anerkennung nötig.
Für Kinder kann die Depression eines oder beider Elternteile verschiedene, zum Teil gravierende Folgen haben. Alle Beziehungen innerhalb eines Familiensystems werden von der Krankheit beeinflusst. Betroffene sind oftmals nicht so responsiv, reagieren also weit verhaltener als andere das tun. Zum Beispiel können sie sich nicht mitfreuen, wenn einem Kind etwas Gutes passiert, sie beteiligen sich weniger bei gemeinsamen Aktivitäten und es kommt häufig zu Missverständnissen. Kinder beziehen die Handlungen der Eltern häufig auf das eigene Verhalten und denken beispielsweise, ihr Elternteil freue sich nicht, weil ihre eigene Leistung nicht gut genug gewesen sei.
Depressive Elternteile sind aber nicht automatisch schlechte Eltern. Innerhalb eines Familiensystems muss zunächst geklärt werden, inwieweit die Betroffenen noch Arbeit, Alltag und die Herausforderungen einer Familie bewältigen können. Mit wirkungsvoller fortschreitender Behandlung können die Betroffenen zunehmend wieder aktiv am Familienleben teilnehmen.
Die Therapie erfolgt je nach Schweregrad. Ab einer mittelgradigen Depression werden neben der Psychotherapie, die bereits ab der leichten Depressionen empfohlen wird, auch Medikamente eingesetzt. Wegen der erhöhten Suizidalität im Zusammenhang mit Depressionen sind Warnzeichen immer ernst zu nehmen. Es muss im Notfall und bei einer ernsten Absichtserklärung sofort gehandelt werden. Hier kann nur eine ausgebildete Fachkraft Hilfestellung leisten und die Situation einschätzen. Bei beginnenden Symptomen können Angehörige und Freund:innen unterstützend zur Seite stehen und zum Beispiel die Betroffenen dazu ermutigen, sich extern professionelle Hilfe zu suchen.

Von Dr. med. Sophie-Kathrin Greiner, Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg;
Beirätin der Goldkind-Stiftung für Kinder aus dysfunktionalen Familien.